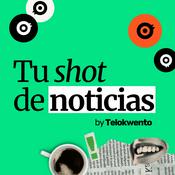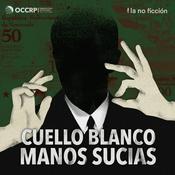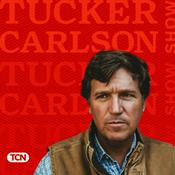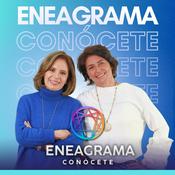130 episodios
- Die südlichste Region Chiles ist ein weitgehend unberührtes Naturparadies. Doch sei es bei der Energiegewinnung oder im Welthandel: Längst sind internationale Player auf die Region aufmerksam geworden. Dort löst dies gemischte Gefühle aus.
Die EU will in naher Zukunft im grossen Stil grünen Wasserstoff aus Chile importieren. Dafür wurden verschiedene Projekte von europäischen Unternehmen angekündigt. In Patagonien sollen mehrere Windparks entstehen. Ein einziger dieser Windparks wäre fast zwei Mal so gross wie der Bodensee.
Salvador Harambour sieht darin ein unglaubliches Potenzial für die Region, die unter starker Abwanderung leidet. Durch die Investitionen entstünden Jobs, die jungen Menschen eine Perspektive böten, so der Interessensvertreter der Energiewirtschaft.
Anders sehen es Umweltschützer. Sie fürchten die Windturbinen würden zur Todesfalle für zahlreiche Vögel, und warnen vor einer Zerstörung des Ökosystems. Ein Ökosystem, das bislang noch weitgehend intakt ist und neben Zugvögeln auch Pinguinen oder Pumas einen Lebensraum bietet.
Chiles neuer Präsident José Antonio Kast, der am rechten Rand anzusiedeln ist, verspricht eine wirtschaftsfreundliche Politik. Während Unternehmer nun auf mehr Tempo hoffen, fürchten Aktivisten und Aktivistinnen den Abbau von Umweltstandards. So, wie es in Argentinien bereits geschieht, wo mit Javier Milei ebenfalls ein rechter Präsident das Land regiert.
Auch im Handel gewinnt Patagonien an Bedeutung: Die Magellanstrasse wird für die globale Schifffahrt immer wichtiger. Strategisch ist die Region als Tor zur Antarktis zudem günstig gelegen. Dies alles hat die Aufmerksamkeit der Grossmächte geweckt, die ihre Präsenz in der Region ausbauen. - Sie kämpfen an der Front, kehren versehrt heim. Und dann? Welche Unterstützung erhalten die «Helden der Spezialoperation» tatsächlich? Calum MacKenzie hat mit russischen Kriegsveteranen gesprochen. Im TALK erzählt er, wie er sie gefunden hat. Und wie er mit dem Risiko der (Selbst-)Zensur umgeht.
- Der russische Krieg in der Ukraine dauert an, und so wächst auch die Zahl jener, die aus dem Krieg heimkehren: verwundet und traumatisiert. Ihre Rückkehr ins zivile Leben ist oft wenig heldenhaft, sondern schwierig und begleitet von Frust und Enttäuschung – über den Staat und ihre Landsleute.
Ist der Krieg gerecht? Oder nicht? Diese Frage hatte sich Jaroslaw* nie gestellt. Bis er in Russlands Krieg gegen die Ukraine zog. Freiheit gegen Kampfeinsatz versprach man dem ehemaligen Häftling. Bei seiner Rückkehr geht Jaroslaw an Krücken, sein verwundetes Bein verheilt nur langsam. Hilfe vom Staat? Fehlanzeige. Der Krieg in der Ukraine: ein «Scheisskrieg».
Vor bald vier Jahren hat Russland diesen Krieg gegen die Ukraine begonnen, hat Schätzungen zufolge seither weit über eine Million Soldaten in den Krieg geschickt. Viele sind bereits zurückgekehrt, ins zivile Leben – versehrt, an Körper und Seele. Der Kreml und die Staatsmedien feiern sie als «Helden der Spezialoperation», doch die Bevölkerung zieht nicht mehr einfach mit, begegnet den «Helden» bisweilen mit Angst und Misstrauen.
Man sollte alle Soldaten mit Kampferfahrung behandeln. Ausnahmslos. Sagt die Psychologin Natalja Nikiforova. Doch dafür fehlt in Russland das Personal. Und der Wille.
«Wir werden auch dies überstehen,» sagt die Psychologin. Doch die Rückkehrer aus dem Krieg – sind ein Faktor mit grossem Konfliktpotential.
*Name geändert - Istanbul präsentiert sich gerne als muslimische Weltmetropole. Doch die Stadt auf zwei Kontinenten war einst ein Schmelztiegel verschiedenster Kulturen. Ceyda Nurtsch erzählt von ihrer Spurensuche bei religiösen und ethnischen Minderheiten. Und von Zuversicht, die sie selbst überrascht hat.
- Istanbul war über Jahrtausende ein «Mosaik der Völker». Doch die nationalistische Staatsideologie der modernen Türkei leugnete die kulturelle Vielfalt. Aber es gibt eine Gegenbewegung: Menschen, die das multikulturelle Erbe der Stadt wiederbeleben wollen.
Die historische Strassenbahn bimmelt auf der Flaniermeile Istiklal Caddesi an armenischen und griechischen Stadtpalästen vorbei. Wer sich umschaut, findet überall in der Bosporus-Stadt Zeugnisse der multikulturellen Vergangenheit. Doch die moderne Türkei verstand sich als Einheitsstaat: «Glücklich, wer ein Türke ist». So der Leitsatz von Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk. Bis heute sind die nationalistischen Strömungen in der Türkei stark. «International» begegnet Menschen, die genug haben von politischer Polarisierung und die multi-ethnische Tradition dieser Stadt auf zwei Kontinenten für sich neu entdecken.
Can Evrensel Rodrik ist fasziniert vom jüdischen Erbe. Er gibt Kurse in der Sprache der sephardischen Juden Istanbuls und schafft so eine Verbindung zur eigenen Herkunftskultur. Mehmet Ugur Korkmaz will mit seinem Podcast «Die Kurden sind in der Stadt» dazu beitragen, dass das «kurdische Istanbul» als Teil der Identität der türkischen Mittelmeer-Metropole wahrgenommen wird. Traditionen, Stimmen, Kulturen und verschiedene Epochen flössen am Bosporus ineinander, das fasziniere sie seit ihrer Kindheit, sagt Kübra Şenyaylar. Die Musikerin bringt die Istanbuler Vielstimmigkeit mit ihrem «Koro Istanbul» zum Klingen.
Más podcasts de Noticias
Podcasts a la moda de Noticias
Acerca de International
Internationale Reportagen und Hintergrundgespräche aus aller Welt. Von und mit den Auslandkorrespondentinnen und -Korrespondenten von Radio SRF.
Das «International» bildet weltweite Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge ab. Wir sind vor Ort und analysieren aus nächster Nähe. In Talks und Hintergrundgesprächen wird das Geschehene und die journalistische Arbeit vertieft und reflektiert.
Sitio web del podcastEscucha International, GBM | Markets & News y muchos más podcasts de todo el mundo con la aplicación de radio.net

Descarga la app gratuita: radio.net
- Añadir radios y podcasts a favoritos
- Transmisión por Wi-Fi y Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatible
- Muchas otras funciones de la app
Descarga la app gratuita: radio.net
- Añadir radios y podcasts a favoritos
- Transmisión por Wi-Fi y Bluetooth
- Carplay & Android Auto compatible
- Muchas otras funciones de la app


International
Escanea el código,
Descarga la app,
Escucha.
Descarga la app,
Escucha.